
Home-Office to go
Ein Leben auf 16 Quadratmetern
Eine Biersorte wird zum Virus, Klo-Papier zu einer Währung und ich zum digitalen Nomaden. Seit fünf Jahren arbeite ich bei Amstutz Partners als Projektleiterin und Texterin, seit beinahe zwei Jahren gehe ich dieser Tätigkeit ausschliesslich online nach – über die gesamte Schweiz und das angrenzende Ausland verteilt. Wo immer ich mit meinem rollenden Zuhause bin, da lebe und arbeite ich. Warum dieser Lebensstil? Und wie vereine ich diesen ungewöhnlichen Alltag mit einer Festanstellung?

(All)tägliche Herausforderungen
Januar 2022. Ein bunt angemaltes Wohnmobil steht mitten in den waadtländischen Bergen. Der Schnee reflektiert die aufgehende Sonne im Panorama vor dem Küchenfenster. Der Kaffee steht bereits auf dem Gasherd neben der warm werdenden Milch. Selbst ein Cappuccino ist in meinem neuen Leben kein Knopfdruck mehr, sondern Handarbeit. Eine Einfachheit, die Selbstbestimmtheit erlaubt: Was immer ich bediene, könnte ich selbstständig reparieren oder austauschen. Welche Ressourcen ich auch immer brauche, ich allein bin dafür verantwortlich.
Noch vor dem ersten Kaffee, habe ich den Schnee vom Dach geschippt und damit die Solarzellen von ihrer Last befreit. Sie sind eine von drei Möglichkeiten, für meinen täglichen Bedarf Strom zu erzeugen und erlauben mir, mein rollendes Zuhause nach Belieben an einem schönen Ort zu parkieren, ganz ohne Ressourcen-Engpässe. Die zweite Möglichkeit ist der sogenannte Landstrom, bedeutet, ich beziehe Strom von einem externen Anschluss. Dem Camping- und Wohnmobil-Boom sei Dank, bieten Bauernhöfe sowie private Anwesen diesen Service vermehrt an. Gerade letztere haben das Potential der Camper entdeckt. Immer öfter finde ich neben Strom, Frischwasser und Duschen ganze Wellness-Oasen vor: da hat man Hotpods, Jacuzzis und Saunas eingebaut, entweder in den Hauskeller oder einer eigens dafür erstellten Holzhütte vor dem Haus. Man fährt also auf den Stellplatz (= Parkplatz für Wohnmobile), mietet die Sauna, bleibt eine Nacht und fährt dann weiter. Ähnliche Modelle bieten auch diverse Restaurants an: ihre grosszügigen Gästeparkplätze werden kurzfristig zu Stellplätzen, auf denen das «Wohnmobil-Dinner» in den eigenen vier Wänden serviert wird. Eine Win-Win Situation: Für die Camper ein sicherer Schlafplatz und Strom, für die Restaurantbetreiber etwas in die Kasse. Gerade sie gehören zu einem der Wirtschaftszweige, die von der Pandemie arg gebeutelt wurden. Die letzte Variante, Strom zu erzeugen, ist das Autofahren selbst. Die Autobatterie speist dann die Zweitbatterie, an der alle Geräte im Wohnraum angeschlossen sind. Dass diese Batterien getrennt voneinander laufen, ist unter Umständen lebenswichtig. Sollte ich bei ‑20 Grad nicht mehr genügend «Saft» in der Zweitbatterie haben, um die Heizung zu betreiben, kann ich trotzdem noch den Motor starten und losfahren. Verkalkuliere ich mich in der Wahl der Möglichkeiten, sitze ich offline, frierend und ohne Licht da. Was in den «Büssli-Ferien» ein Abenteuer ist, bedeutet für mich nicht erwünschter Nervenkitzel.
«Ich empfand meine Wohnung als zu gross und zu starr. Ich suchte das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit.Ich wollte mir den Luxus leisten, mit weniger zu leben.»

Planung ist das halbe Leben
Mein Tank fasst 80 Liter. Damit koche, putze und dusche ich für drei Tage, ohne nachzufüllen. Zum Vergleich: Wer ein Bad nimmt, verbraucht auf einmal 150–180 Liter. Wir alle wissen, wie wertvoll Wasser ist. Nur selten verschwenden wir jedoch einen Gedanken daran, wie unser Trinkwasser aufbereitet wird. Damit wöchentlich konfrontiert zu werden, war auch für mich eine Umstellung. Nicht immer finde ich zuverlässige, saubere Quellen, weswegen mein Tank mit Sieben versehen ist, die Silber-Ionen abgeben. Sie filtern unerwünschte Partikel aus und eliminieren Bakterien. Trotzdem plane ich meine Routen so, dass ich an offizieller Stelle frisches Wasser auffüllen kann. Gerade im Ausland hat mir das so manche Magenverstimmung erspart. Ebenfalls einberechnen muss ich Abwasserstationen: mein Grauwasser verschwindet nicht mehr einfach im Abfluss. Ich sammle es in einem grossen Auffangtank am Unterboden des Fahrzeuges, der ca. ein Mal die Woche geleert werden muss. Es einfach in die Erde versickern zu lassen, wäre – zu Recht! – strafbar. Gerade im Winter ist das Risiko hoch, dass die Leitungen gefrieren. Daher mische ich das Trinkwasser mit etwas Salz und gebe dem Abwasser Frostschutz bei. Für die Natur wäre das hochgiftig.
Waschtag ist für mich Besuchstag: In der Schweiz bei der Familie, Freunden sowie Camping- oder Stellplatz-Betreibern. Im Ausland suche ich, ganz altmodisch, Waschsalons auf. In normalen Zeiten ist das relativ einfach. Zu Zeiten von resoluten Lockdowns und Verordnungen, hatte das Sauberhalten meiner Kleidung jedoch ebenfalls Einfluss auf die Routenplanung: Ich sah mich teilweise gezwungen, alles in eine grosse, natürlich unbenutzte, Vieh-Futtertonne zu stecken, diese mit Wasser und Waschmittel zu füllen, in die Mitte des Wohnmobils zu legen und einen Pass rauf- und runterzufahren. Der gute alte Schleudergang, sozusagen.
Kurzum: Ohne das Kontrollieren von prognostizierten Sonnenstunden via App, ohne das Kalkulieren meines täglichen Verbrauchs und – ganz profan – ohne ausreichende Internetverbindung, wäre dieses Nomadenleben nicht mit einer Festanstellung vereinbar. Jeder alltägliche Schritt ist für mich eine Spur zeit- und planungsintensiver. Und für alle, die verklärende Bilder von Reisenden in ihren Vans und Wohnmobilen sehen: das sind Momentaufnahmen. Momente, für die man diesen Alltag gerne in Kauf nimmt. Aber ein Moment dauert laut Definition genau 90 Sekunden – deshalb empfehle ich allen, die in diesen Bildern die grosse Freiheit sehen, über die restlichen 86’310 Sekunden des Tages genau nachzudenken.
«Für alle, die verklärende Bilder von Reisenden in ihren Vans und Wohnmobilen sehen: das sind Momentaufnahmen.»


«To go» mit Tücken
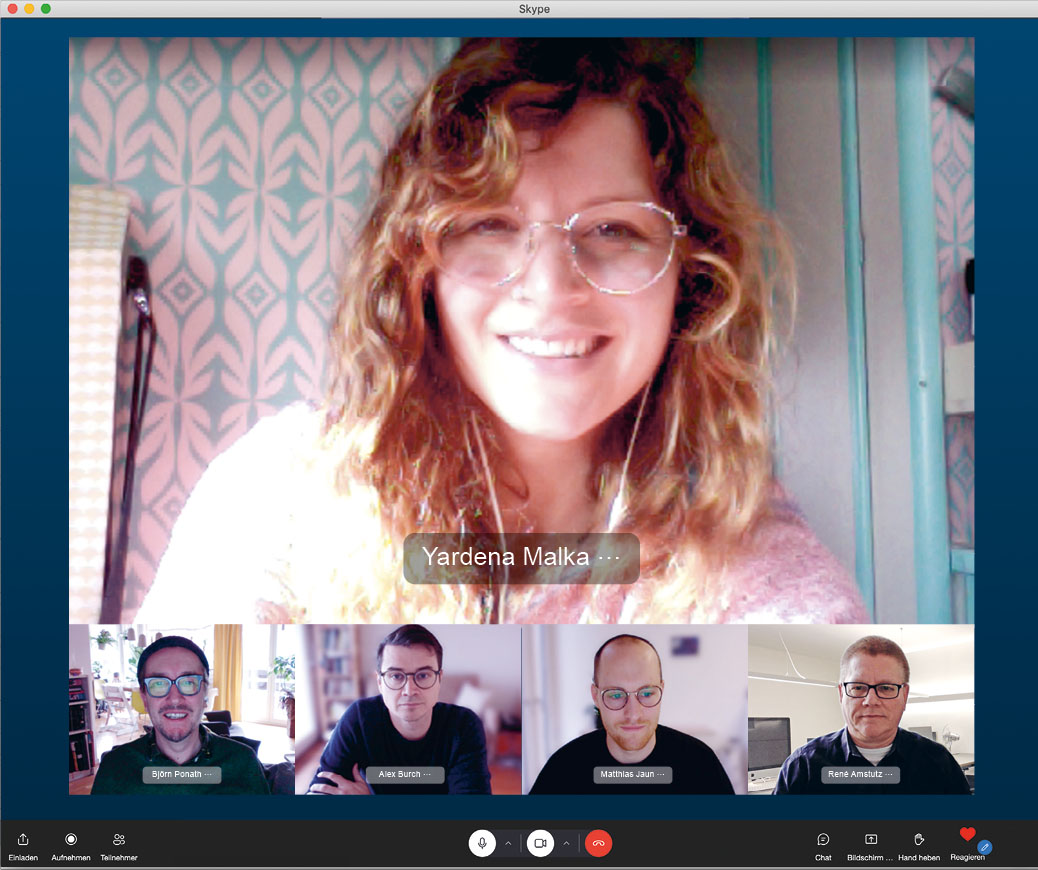
«Warum lebst du so?»


